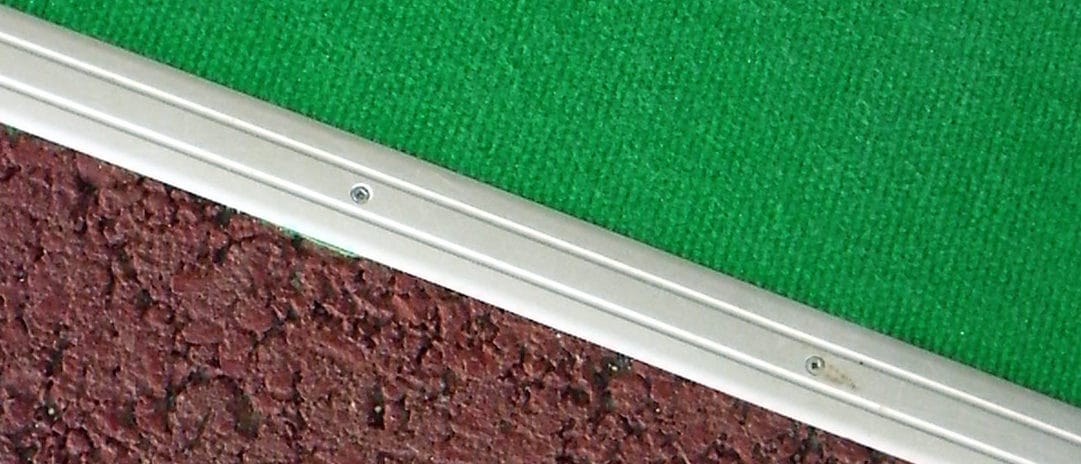von Annik Rubens | 3. Dezember 2011 | Deutsche Medien, Kunst und Kultur, SG Podcast-Episode
Pál aus Rumänien und Miranda aus England interessieren sich für die Radiosender in Deutschland. Radio ist für Euch alle wichtig: Wenn Ihr Deutsch lernt, ist es eine gute Möglichkeit, Euer Hörverständnis zu verbessern. In Deutschland gibt es viele verschiedene Radiosender. Ich werde versuchen, Euch das System zu erklären.
Zunächst einmal gibt es die so genannten öffentlich-rechtlichen Radiosender. Das bedeutet, dass sie durch Gebühren finanziert werden. Jeder Deutsche, der ein Radiogerät hat, zahlt dafür Gebühren. Auch, wenn er zum Beispiel ein Autoradio besitzt. Von diesem Geld werden die öffentlich-rechtlichen Radiosender finanziert. Diese Sender haben einen so genannten Bildungsauftrag. Sie sollen die Hörer also nicht nur unterhalten, sondern auch informieren.
Die öffentlich-rechtlichen Sender strahlen ihr Programm landesweit aus. Fast jedes Bundesland hat seine eigenen Sender. Hier in Bayern gibt es zum Beispiel den Bayerischen Rundfunk. Er ist unterteilt in fünf verschiedene Radiosender. Jeder Sender hat andere Inhalte. Bayern1 spielt zum Beispiel eher Musik aus den 60er-Jahren. Bayern2 sendet viele gesprochene Inhalte und auch Hörspiele. Bayern3 ist die Massenwelle, die meisten Menschen hören diesen Sender. Dort wird ein typisches Programm gemacht, aktuelle Musik aus der Hitparade, also aus den Top Ten, aus den Charts, viele Witze und lustige Moderatoren. Ich mag diese Art von Radio nicht so gerne. Bayern4 sendet den ganzen Tag klassische Musik, also Mozart und Beethoven und so weiter. Und Bayern5 ist ein reiner Info-Sender, hier laufen die ganze Zeit Nachrichten und Magazine mit journalistischem Inhalt.
Ähnlich ist es in anderen Bundesländern. Es gibt den SWR in Baden-Württemberg, den WDR in Nordrhein-Westfalen, den RBB in Berlin-Brandenburg und so weiter. Übrigens: All diese Sender haben auch Podcasts! Googelt einfach mal danach oder schaut bei iTunes. Ich empfehle Euch an dieser Stelle zum Beispiel den Interview-Podcast SWR1 Leute.
Neben den öffentlich-rechtlichen Radiosendern gibt es auch private Sender. Diese Sender finanzieren sich nicht über Gebühren, sondern über Werbung. Privatradios existieren in Deutschland seit fast 30 Jahren. Diese Sender sind in der Regel mehr auf Unterhaltung spezialisiert, hier gibt es oft Gewinnspiele zu hören und viel Musik, weniger gesprochene Texte.
Noch ein paar Begriffe, die Ihr im Zusammenhang mit dem Rundfunk kennen solltet. Die Menschen, die im Radio sprechen, nennt man Moderatoren. Wichtige Elemente einer Radiosendung sind meistens die Nachrichten zur vollen oder halben Stunde, die Wettervorhersage und Verkehrsmeldungen – also wo gerade Staus sind oder Unfälle passiert sind. Um einen bestimmten Radiosender zu finden, sollte man seine Frequenz kennen, dann ist die Suche einfacher. Denn jeder Sender sendet sein Programm auf einer bestimmten Frequenz, und zwar zum Beispiel auf 97,3 UKW, das steht für Ultrakurzwelle, im Amerikanischen ist das FM.
Mittlerweile empfängt man die meisten Radiosender auch im Internet oder kann Podcasts von einzelnen Sendungen herunterladen. Wenn Ihr einen guten Radiopodcast findet, der auch für Deutschlernende geeignet ist, dann schreibt doch bitte in die Kommentarfunktion auf slowgerman.com, dann freuen sich die anderen Hörer.
Das war’s schon wieder für heute, ich danke Euch für’s Zuhören! Demnächst wird es einige Neuerungen auf slowgerman.com geben, also haltet die Augen offen. Wenn Ihr Themenvorschläge für mich habt, schreibt an podcast@slowgerman.com und ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen von Euch, die mich unterstützt haben! Schöne Grüße aus Deutschland, Eure Annik.
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg67kurz.pdf
von Annik Rubens | 12. September 2011 | Freundschaft & Familie, SG Podcast-Episode
Monica aus den USA hat mich gefragt, welche Kosenamen wir in Deutschland verwenden. Dazu muss ich erstmal erklären, was ein Kosename ist. Wenn Menschen sich sehr gern haben oder sich lieben, dann verwenden sie oft andere Namen für einander. Das nennt man dann Kosenamen.
Der häufigste Kosename in Deutschland ist Schatz. Ein Schatz ist etwas sehr wertvolles. In Geschichten über Piraten gibt es meistens eine Schatzkiste, also eine Kiste voller Gold oder Geld, der irgendwo versteckt war. Ein Schatz ist etwas, das einem Menschen sehr wichtig ist. Kein Wunder also, dass sowohl Frauen ihre Männer gerne Schatz nennen, als auch Männer ihre Frauen.
Oft verwenden Liebende auch Tiernamen als Kosenamen. Ein eher dicker, kuscheliger Mann wird zum Beispiel gerne „Bärchen“ genannt, oder auch Männer mit Bart zum Beispiel. Frauen dagegen werden „Hase“ oder „Maus“ genannt. Oder Spatz, das ist ein kleiner Vogel. Man verwendet auch gerne die Verniedlichungsform, also Häschen oder Mäuschen. Oder Spätzchen. Schwer auszusprechen, oder?
Frauen werden von ihren Männern auch gerne Engel genannt, ein Engel ist ja normalerweise ein göttliches Wesen, mit blondem Haar und Flügeln.
Oder einfach Süße. So wie es in Amerika „Sweetie“ ist.
Oder Sonnenschein – aber das geht nur bei fröhlichen Frauen, oder?
Man sagt auch gerne Liebste oder meine Liebe zu der geliebten Frau. Oder englisch „Baby“.
Für Männer gibt es die männlichen Formen, Liebster oder Süßer. Oder man sagt Liebling zueinander. Ein sehr netter Kosename ist „Herzblatt“. Das ist eigentlich eine kleine Blume.
Und natürlich geben nicht nur Liebende sich Kosenamen. Vor allem Eltern haben für ihre Kinder verschiedene Kosenamen. Oder man gibt den eigenen Haustieren Kosenamen. Mein Kater heißt eigentlich Tiger, aber ich nenne ihn zum Beispiel oft Schnitzel. Oder auch Mäuschen. Komisch, oder?
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg66kurz.pdf

von Annik Rubens | 20. August 2011 | Freundschaft & Familie, Gesundheit & Soziales, SG Podcast-Episode
Tam aus Pennsylvania hat mich gefragt, wie es den alten Menschen in Deutschland geht. Ich werde versuchen, einige Antworten zu geben.
Alte Menschen nennt man in Deutschland Senioren. Sie bekommen Ermäßigungen bei verschiedenen Einrichtungen. Das heißt, sie können zum Beispiel ins Museum gehen und müssen weniger Eintritt bezahlen. Alte Menschen sind in Deutschland in der Regel noch sehr fit, sie sind gesundheitlich im Vergleich zu vielen anderen Ländern gut versorgt, aber natürlich gibt es auch hier Probleme.
In Deutschland hören ältere Menschen normalerweise auf zu arbeiten. Man sagt dann, jemand geht in Rente oder er geht in Pension. Die meisten Menschen hören auf zu arbeiten, wenn sie zwischen 60 und 65 Jahre alt sind. Angenommen, ein Mensch arbeitet 45 Jahre lang in Deutschland. Dann zahlt er jeden Monat Geld an die gesetzliche Rentenversicherung. Und die Firma, bei der er arbeitet, tut das auch für ihn. Wenn er dann zum Beispiel 45 Jahre lang gearbeitet hat, dann kann er aufhören zu arbeiten – und bekommt trotzdem weiterhin Geld. Er bekommt seine Rente jeden Monat ausbezahlt.
Das ist vor allem deswegen wichtig, weil die Struktur der Gesellschaft sich verändert hat. Früher lebte man in einer Großfamilie. Mehrere Generationen lebten unter einem Dach. Also lebte die Oma gemeinsam mit ihrer Tochter, dem Enkel, der Tante oder den Onkeln oder anderen Familienmitgliedern zusammen. Das hatte viele Vorteile. Die Oma konnte beispielsweise auf die Enkel aufpassen, wenn die Eltern arbeiten gingen. Dafür versorgten die Eltern die Oma, wenn sie alt wurde und Pflege brauchte. Heute leben aber nur noch wenige Deutsche in einer Großfamilie. Vor allem in den Großstädten. Durch die Rente können sie sich auch im Alter das Leben finanzieren.
Wer gesund bleibt, der kann auch im hohen Alter alleine leben. Weil das natürlich alles schwerer wird, wenn der Körper langsam alt wird, kann man sich Hilfe holen. Man kann sich zum Beispiel Essen liefern lassen, zum Beispiel über einen Dienst, der „Essen auf Rädern“ heißt. Oder Zivildienstleistende helfen der alten Person im Alltag. Zivildienstleistende sind junge Männer, die nach der Schulzeit einige Monate bei sozialen Diensten arbeiten.
Es gibt auch das so genannte Betreute Wohnen. Hier hat der alte Mensch seinen eigenen Lebensbereich gekauft oder gemietet, ein Zimmer oder eine Wohnung. Je nachdem, welche Hilfe er im Laufe der Zeit braucht, wird ihm diese gewährt. Das kostet natürlich Geld. Eine andere Alternative sind Altenheime. Hier leben alte Menschen zusammen und werden betreut, jeder von ihnen hat aber weiterhin sein eigenes Zimmer. Auch in Deutschland werden die Menschen immer älter, und viele von ihnen haben Krankheiten wie Alzheimer. Gerade diese Personen können oft nicht mehr in ihrer eigenen Familie betreut werden, sondern brauchen Fachpersonal, das sich um sie kümmert. Es gibt verschiedene Versicherungen, die die Kosten für diese Betreuung übernehmen. Fast jeder Deutsche zahlt in die Rentenversicherung ein und in die Pflegeversicherung. Gepflegt wird man, wenn man alt und krank ist. In Pflegeheimen sieht es eher aus wie in einem Krankenhaus – oft liegen hier mehrere Menschen in einem Zimmer.
Wir wünschen uns jedenfalls, dass wir alle möglichst gesund alt werden und das Leben genießen können. Oder? Und die deutschen Senioren scheinen ziemlich fit zu sein – zumindest sind viele von ihnen im Internet – man nennt sie auf Englisch Silver Surfer.
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg65kurz.pdf

von Annik Rubens | 2. August 2011 | Bildung & Wirtschaft, Gesundheit & Soziales, SG Podcast-Episode
Marie-Françoise ist Lehrerin aus Belgien. Sie hat mich gebeten, über Ferienjobs zu sprechen. Also werde ich das heute machen.
Viele Schüler und Studenten arbeiten in ihren Ferien. So verdienen sie Geld und machen neue Erfahrungen. Schüler unter 15 Jahren dürfen in Deutschland nicht wie ein Erwachsener arbeiten. Es gibt ein Gesetz, das Kinderarbeit verbietet. Eine Ausnahme gibt es aber: Wenn es die Eltern erlauben, dürfen Kinder schon ab 13 Jahren arbeiten. Aber nur zwei Stunden pro Tag und nur tagsüber. Und natürlich nicht während der Schulzeit. Anders ist es in den Ferien. Hier dürfen Schüler zwischen 15 und 18 Jahren maximal vier Wochen im Jahr arbeiten, höchstens aber acht Stunden pro Tag.
Beliebte Jobs für Schüler sind zum Beispiel Babysitten, Zeitungen austragen oder Nachhilfe geben. Babysitten ist klar – da passt der Schüler auf ein kleineres Kind auf und bekommt von dessen Eltern Geld dafür. Zeitungen austragen bedeutet, dass Schüler mit dem Fahrrad oder zu Fuß von Haus zu Haus gehen, und kostenlose Blätter für einen Verlag ausliefern. Sie stecken also in jeden Briefkasten ein Exemplar und werden dafür bezahlt. Wenn ein Schüler Nachhilfe gibt bedeutet das, dass er einem anderen Schüler hilft, der in einem Schulfach schlechter ist. Sie lernen also zusammen, und die Eltern bezahlen den Nachhilfelehrer dafür. In der Regel gibt ein älterer Schüler einem jüngeren Schüler Nachhilfeunterricht in einem Fach, also zum Beispiel in Mathematik oder Englisch.
Wer nur in den Ferien arbeitet, der macht meistens einfache Saison-Arbeit. Zum Beispiel kann ein Schüler als Eisverkäufer arbeiten. Dann verkauft er Eis an Kinder und Erwachsene. Er kann auch als Pizzabote arbeiten. Dann liefert er Pizza an Menschen, die diese per Telefon bestellt haben. Wer sportlich ist und gut schwimmen kann, kann nach einer speziellen Ausbildung auch als Rettungsschwimmer arbeiten. Dann sitzt er an einem See oder in einem Schwimmbad und passt auf, damit niemand ertrinkt.
Studenten arbeiten im Sommer gerne als Animateur in einer Hotelanlage. Das heißt, sie leben selber im Ausland, in Spanien oder Italien zum Beispiel, und arbeiten im Hotel. Sie machen mit den Gästen spezielle Programme, meistens ist das Sport. Sie arbeiten oft aber auch in Restaurants oder Cafés als Kellner oder Kellnerin. Sie bringen also Getränke und Essen zu den Gästen.
Warum Schüler und Studenten arbeiten? Natürlich denkt man bei dieser Frage sofort an Geld. Und das ist bestimmt für viele die Hauptmotivation. Mit etwas mehr Taschengeld kann sich ein Schüler vielleicht die Computerspiele, Bücher oder Musik kaufen, die er sich sonst nicht leisten könnte. Ein Student kann mit dem zusätzlichen Geld vielleicht hin und wieder einen Cocktail trinken gehen oder mit Freunden ins Kino. Es gibt aber noch einen Grund, warum Ferienarbeit sehr gut ist: Schüler lernen dadurch, was es bedeutet, zu arbeiten. Sie müssen pünktlich am Arbeitsplatz sein, sie müssen eine Aufgabe erfüllen und viele Stunden etwas tun, was ihnen wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht, wie mit den Freunden Zeit zu verbringen. Und bei manchen Ferienjobs lernen die Schüler und vor allem Studenten schon etwas für ihren späteren Beruf. Ich selber habe in den Ferien und nach der Schule immer bei einem Radiosender gearbeitet und dort viel gelernt. Vielleicht hätte ich ohne diesen Ferienjob nie angefangen, zu podcasten!
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg64kurz.pdf

von Annik Rubens | 20. Juli 2011 | Freundschaft & Familie, Gesundheit & Soziales, SG Podcast-Episode
Heute werde ich über Kinder sprechen. Jack lebt in New York und ist Kinderarzt. Ihn interessiert, wie es in Deutschland den kranken Kindern geht.
Fangen wir mit den ganz kleinen Kindern an. In der Regel werden Kinder in Deutschland im Krankenhaus geboren. Kaum sind sie wenige Tage alt, bekommen sie auch schon ihre eigene Versichertenkarte. Eine Versichertenkarte sieht aus wie eine Kreditkarte. Sie ist klein und aus Plastik. Auf ihr sind viele Informationen gespeichert. In diesem Fall geht es darum, dass das Kind ab der Geburt krankenversichert ist. Wenn es also krank wird oder sogar ins Krankenhaus muss, zeigt man diese Karte, und die Ärzte wissen, wer die Untersuchungen bezahlt. Natürlich muss nicht das Kind bezahlen, sondern die Eltern. Sie bezahlen jeden Monat einen Geldbetrag an die Krankenkasse. Dafür sind viele Untersuchungen und Operationen dann kostenlos.
Natürlich hoffen alle Eltern, dass ihre Kinder nie krank werden. Wenn es aber doch passiert, oder sich das Kind verletzt, gibt es spezielle Kinderärzte. Ihre Praxen sind meistens so eingerichtet, dass Kinder sich dort wohl fühlen und keine Angst vor der fremden Umgebung haben. Alles ist bunt und es gibt viel Spielzeug dort. Auch die Ärzte haben meistens keinen weißen Kittel an, wie sonst, sondern bunte Hemden.
Jedes Baby und jedes Kind muss regelmäßig zum Arzt. Denn es wird dort bei den U-Untersuchungen kontrolliert. Die Ergebnisse dieser Kontrollen werden in ein kleines Heft eingetragen. So sieht der Arzt, ob sich das Kind gut entwickelt, ob es groß genug und schwer genug ist und ob es gesund ist. Die Kinder werden beim Arzt natürlich auch geimpft. Die Impfungen erfolgen in einem vorgegebenen Zeitrahmen, also in bestimmten Abständen. In den ersten Lebensmonaten wird das Kind sehr oft geimpft, später dann weniger. So soll es geschützt sein vor vielen Krankheiten wie Mumps, Masern oder Röteln.
Wer Kinderarzt werden möchte, muss zunächst Medizin studieren. Das dauert meistens sechs Jahre, also zwölf Semester lang. Das letzte Jahr ist allerdings ein Praktikum in einem Krankenhaus. Hier arbeiten die jungen auszubildenden Ärzte also schon mit. Nach dem Studium geht die Ausbildung weiter mit der Facharztausbildung. Das bedeutet, dass sich die Studenten auf ein Fachgebiet spezialisieren. Diese Ausbildung zum Kinderarzt zum Beispiel dauert noch einmal fünf Jahre lang. In dieser Zeit verdient man allerdings schon Geld und wird Assistenzarzt genannt. Nach der Ausbildung hat man zwei Möglichkeiten: Man arbeitet entweder weiter in einem Krankenhaus, oder man arbeitet in einer Praxis. Eine Praxis ist sozusagen das Büro eines Arztes.
Wenn ein Kind sehr krank ist, muss es in eine Kinderklinik. Das sind Krankenhäuser speziell für Kinder. Kinderkliniken gibt es vor allem in größeren Städten. Meistens können die Eltern bei ihren kranken Kindern bleiben – es gibt auch Stiftungen wie die Ronald McDonald-Stiftung, die spezielle Häuser für die Eltern gebaut haben, damit diese auch bei ihren Kindern bleiben können, wenn diese schwer krank sind und lange im Krankenhaus bleiben müssen.
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg63kurz.pdf

von Annik Rubens | 3. Juli 2011 | Absolute Beginner, SG Podcast-Episode
Jacqueline asked me to produce this beginner’s show. She wanted to know what the furniture in a room is called in German. So let’s start our tour through a virtual apartment. If you enter a typical German apartment, you open the door, die Türe, die Türe, and get into a corridor. It is called Flur. Here you can take your shoes off and put your coat on a hanger. The place to store your shoes and coat is called Garderobe. Garderobe. It is the cloakroom. But now off on our tour!
We start with the living-room. It is called Wohnzimmer in German. Wohnzimmer. In the living-room there’s usually a place to sit, for example a couch. We also call it a couch in German. Or sofa. If you sit on a sofa and want to drink something, you put it in front of you on a small table. That table is called Couchtisch. Couch-Tisch.
In some living-rooms there’s also a space for dining. But many homes have a separate area that is called Esszimmer. Dining room. Ess-Zimmer. The main piece of furniture here is a table. It is called Tisch in German. Tisch. You sit at a table. And you sit on chairs. Chairs are called Stühle. One chair is a Stuhl. More chairs are Stühle. Stühle.
We go through to the bedroom. It is called Schlafzimmer in German. Schlafzimmer. The main thing in a bedroom is the bed, of course. And that one is easy to remember, it is called Bett in German. Bett. Beside the bed there is a small table to put books on. It is called a Nachttisch. Nacht-Tisch. On it there is a lamp. The Nachttischlampe. Nacht-Tisch-Lampe. You put your clothes in a wardrobe, it is called Schrank in German. Schrank.
What more is there to tell you? If you want to store your books somewhere, you put them on a shelf. A shelf is a Regal. Regal. I think that’s enough for today. Have fun learning German!
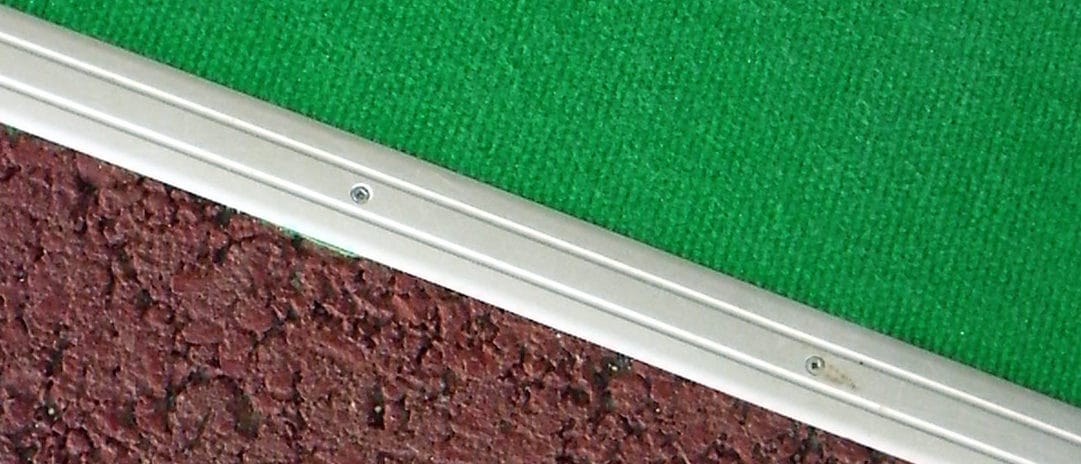
von Annik Rubens | 20. Juni 2011 | SG Podcast-Episode, Sprache
Ich habe auf der Facebook-Seite von Slow German eine Umfrage gemacht. Dort habe ich Euch gefragt, welches Thema ich als nächstes behandeln soll. Mit großer Mehrheit habt Ihr Euch für die Umgangssprache entschieden.
Ich muss aber sagen, dass es gar nicht leicht ist, über die Umgangssprache zu sprechen! Was ist eigentlich Umgangssprache? Natürlich hat jede Region bestimmte Wörter, die man nie geschrieben sieht, sondern nur gesprochen hört. Aber das ist doch dann eher ein Dialekt, oder? Das wollte ich hier also eigentlich nicht zum Thema machen, um Dialekte wird es in einer anderen Episode gehen. Dann gibt es Anglizismen, die auch in der Umgangssprache vorkommen – aber dafür gibt es ja schon die Folge über Denglisch.
Nach langem Überlegen dachte ich mir, ich werde Euch einfach ein paar Beispiele für Umgangssprache nennen. Also für Wörter, Sätze oder Formulierungen, die in der Schriftsprache eigentlich nie auftauchen, die man aber hört, wenn man in Deutschland Menschen belauscht. Angenommen, wir sind in einer U-Bahn. Es ist Samstag, später Abend, und viele Leute sind unterwegs. Da sagt eine junge Frau: „Ich werde heute nicht mehr alt.“ Das klingt eigentlich so, als würde sie Selbstmord begehen, oder? Aber nein, keine Angst. Was sie sagen will ist: Ich bin müde, ich gehe bald ins Bett, ich halte nicht mehr lange durch heute.
Dann hören wir zwei Teenagern zu. Einer sagt: „Willst Du noch eine Runde daddeln?“ Damit will er seinen Kumpel fragen, ob er noch ein wenig computerspielen möchte. Der andere sagt: „Nee. Was kommt denn heute in der Glotze?“ Nee ist umgangssprachlich für Nein. Und die Glotze ist der Fernseher. „Ich will heute Abend glotzen“ heißt also: „ich will heute Abend fernsehen“. In manchen Regionen sagen die Menschen übrigens nicht fernsehen, sondern fernschauen. Oder noch schlimmer: Fernsehen schauen.
Wir lauschen weiter den Menschen in der U-Bahn. Ein Mann sitzt betrunken in einer Ecke. Da hören wir eine junge Frau zu ihrer Freundin sagen: „Schau mal, der ist total blau“. Obwohl seine Gesichtsfarbe natürlich ganz normal aussieht. Wenn die Freundin nicht versteht, was das bedeuten soll, sagt die junge Frau: „Du stehst aber ganz schön auf dem Schlauch“. Das heißt, es dauert zu lange, bis sie es versteht. Die Frau findet das nicht nett, sie hält ihre Freundin für verrückt und sagt: „Du hast eine Meise“. Wenn sie aber nur schlechte Laune hat, ohne Grund, dann ist sie vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das sagt man so. Das ist eine Redewendung – aber auch darüber müssen wir in einer anderen Folge mal ausführlicher sprechen.
Es gibt einige Ausrufe, die typisch sind für die Umgangssprache. Boah ey zum Beispiel. Das ist ein Ausdruck des Erstaunens, der hauptsächlich von Jugendlichen zu hören ist. Sehr gebildet oder klug klingt das übrigens nicht. Als Bestärkung kann man sagen: „Das gefällt mir eh nicht“. Das „eh“ steht dabei für sowieso. Oder ein Fragewort, das vor allem in Süddeutschland oft gebraucht wird: „Es ist schön heute, gell?“ Das „gell“ heißt so viel wie „nicht wahr?“ oder „meinst Du nicht auch?“.
Typisch in der Umgangssprache ist es natürlich auch, neue Wörter zu finden. Aus dem Hund wird ein Köter oder eine Fußhupe. Aus der Katze ein Stubentiger. Aus Brüsten werden Möpse, aus Geld wird Kohle. Wer lernen muss, der paukt. Obwohl das nichts mit der Pauke, also einer großen Trommel, zu tun hat. Wer schnell viel isst, der mampft. Das ist ein schönes Wort, finde ich, da es sich so anhört wie jemand, der mit vollen Backen kaut. Mampfen.
Und weil man in der Umgangssprache zu faul ist, lange Wörter auszusprechen, werden sie einfach abgekürzt. Die Lokomotive wird zur Lok, das Abitur zum Abi und die Mathematik wird zu Mathe.
Natürlich verändert sich die Umgangssprache über die Jahre. Wer früher, also vor 50 Jahren, etwas gut fand, der sagte dazu dufte, prima oder famos. All diese Wörter verwendet heute leider niemand mehr. Ein Teenager war damals ein Backfisch. Schön, oder? Heute ist etwas eher cool oder toll. Oder geil. Das ist ein Wort, das die Jugendlichen alle benutzen – die älteren aber zucken zusammen, weil es früher einen sexuellen Kontext hatte. Welchen? Das müsst Ihr selber nachlesen.
Das war Slow German für heute. Weitere Informationen findet Ihr unter slowgerman.com, dort könnt Ihr die Texte zu den Folgen als PDF herunterladen, dazu noch Lernmaterial, und alle alten Folgen, und dort findet Ihr auch die Links zu Facebook und Twitter – und Informationen, wie Ihr diesen Podcast unterstützen könnt, damit ich noch mehr Episoden produzieren kann. Viel Spaß beim Deutsch lernen! Eure Annik
Text der Episode als PDF: https://slowgerman.com/folgen/sg62kurz.pdf
von Annik Rubens | 22. März 2011 | Deutsche Musik
Ich habe beschlossen, Euch regelmäßig auch deutsche Musik zu empfehlen. Mit deutscher Musik könnt Ihr auch die deutsche Sprache lernen! Nach Roger Cicero und Gisbert zu Knyphausen geht es jetzt weiter mit Ina Müller. Sie ist in Deutschland vor allem aus dem Fernsehen bekannt. Denn sie hat eine eigene Show, „Ina’s Nacht“. In dieser Show hat sie zwei Gäste, und mit diesen Gästen spricht sie in einer Kneipe. Vor der Tür der Kneipe steht ein Shanty-Chor und singt. Ina Müller ist frech, manchmal derb, schlagfertig und hat eine rauchige, tiefe Stimme. Und mit dieser Stimme singt sie auch gerne. Die Texte vieler ihrer Lieder schreibt Frank Ramond, einer der besten deutschen Texter. Und sie kann auch plattdeutsch singen, weil sie aus Norddeutschland stammt (deswegen versteht Ihr im Video nichts!). Ein paar Links zu ihr:
Ina Müllers Internet-Seite
CD „Das wär dein Lied gewesen“ bei Amazon.de / iTunes Deutschland
CD „Weiblich. Ledig. 40.“ bei Amazon.de / Amazon.com / iTunes Deutschland
Ina Müller bei iTunes USA